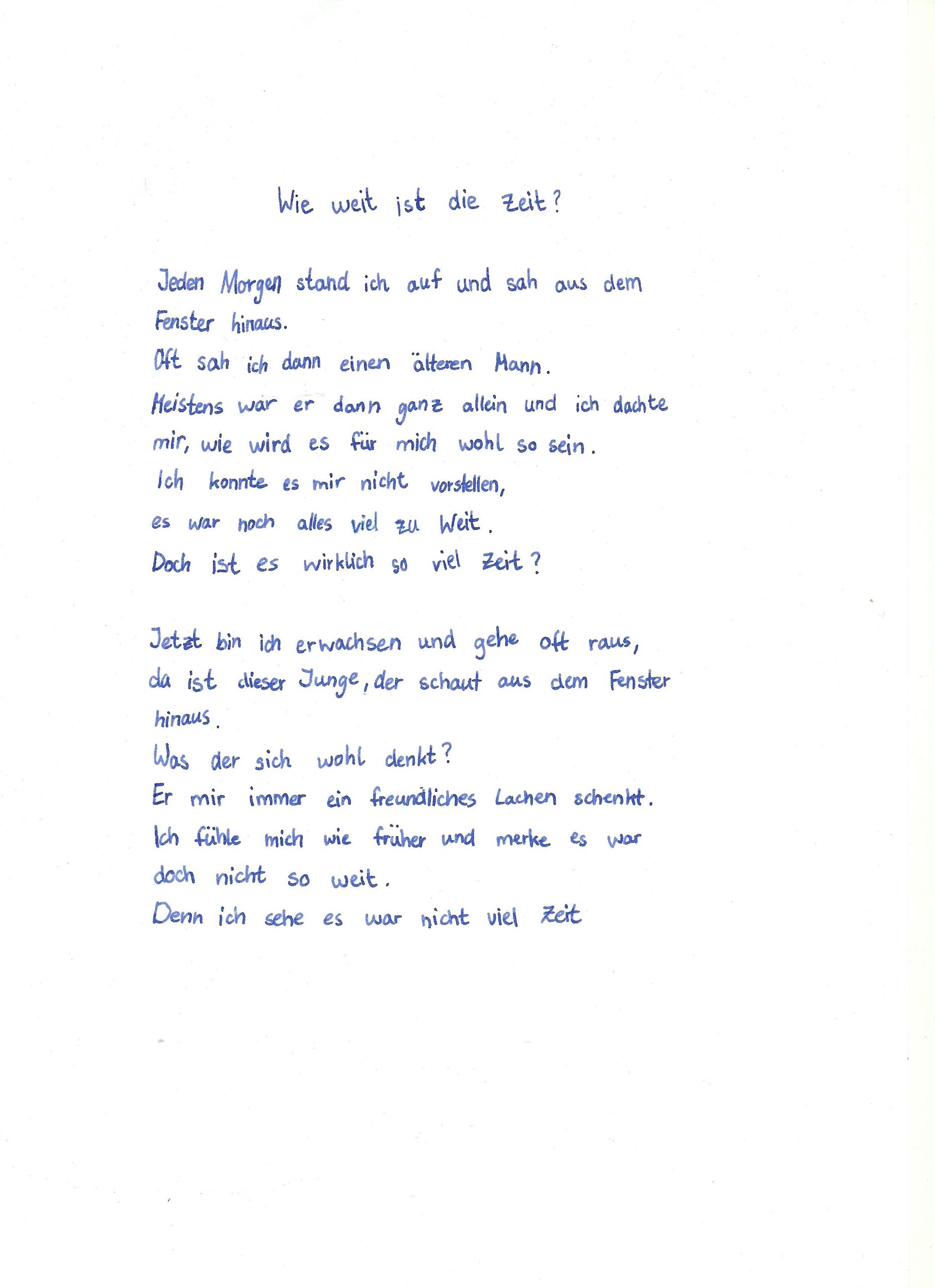Kurzgeschichte zum Thema „frei“
Die Hochhäuser schmolzen hinter ihm, wie Träume, die er nie zu deuten vermocht hatte, während sich die Landschaft im grünen Nirgendwo verlor. Diese Stadt, die für ihn und seine Familie ein Zuhause war, schien nun mehr wie ein Fremder, stillstehend in der Ferne und übertönt durch das laute Brummen des Wagens. Wie einen Taugenichts zog es ihn und sein treues Ross, ein kleiner Toyota mit großväterlichem Rost an der Stoßstange, in das verschwimmende Dunkelgrün der freien Natur. War es doch gerade diese, nach der der junge Student sich sehnte. Während er weiter und weiter fuhr, dachte er an sein Leben in der Stadt zurück, sein Wabern in sinnloser Materie, alleine und grundlos. Sein Streben nach Fleiß und Wohlstand schien ihm sein Ziel, seine Bestimmung im Leben geraubt zu haben. Entrissen hatte es ihm die romantische, jugendliche Freiheit, die seine Freunde in feierlichem Treiben manifestiert sahen, doch wollte er nicht daran denken und richtete seine Augen in Richtung der endlosen, wenn auch befremdlichen Straße. Ohne Ziel, aber mit dem Willen eines zu finden.
Nach einer langen Zeit, deren Spanne und Charakter er niemals zu deuten vermochte, verließ er den grauen Pfad und fuhr tief in den Wald, belästigt durch die pralle Sonne und ihre ewige Hitze. Nun wurde es ruhig um ihn:
Das erste Mal seit einer langen Zeit entrann ihm ein kindliches Lächeln, geboren durch die innere Neugier nach dem Unbekannten, etwas Menschliches, dass ihm nun unerträglich schien. Der Junge verließ sein Auto, nahm sich eine weiße Wolldecke von der vollgepackten Rücksitzbank und trat, nachdem er seinem treuen, alten Freund einen warmen Blick zugeworfen hatte, in die grünen Gräser, die sich um die majestätischen Eichen tummelten. Die Luft um ihn herum schien anders, losgelöster von den dunklen Smoggestalten, die diese im städtischen Trubel umringten. Nach drei vollen Atemzügen schlenderte er weiter durch die grüne Idylle, begleitet von dem Schein der Mittagssonne, die nun, statt erbarmungsloser Hitze, güldenes Licht über die Wälder legte. Noch lange wanderte er durch die Sträucher, angetrieben von dem Gedanken in der absoluten, unberührten Freiheit seinen Sinn zu finden. Doch war es nun schon Nachmittag und in ihm stieg das große Bedürfnis nach einer Mahlzeit. Drum drehte er sich um und wollte zurück zu seinem Wagen laufen, jedoch konnte er diesen nicht sehen. Auch war er aus freudiger Lust mal hier mal dorthin gelaufen, so war ein gerader Rückweg, wie auf der glatten Landstraße, unmöglich für ihn. Plötzlich machte sich Panik in seinem Herzen breit: Würde er den Weg zurückfinden? Müsse er nun verhungern? Vielleicht wäre dies sogar besser als im Lärm des Großstadttrubels das Zeitliche zu segnen.
Entrüstet von seinen eigenen Hirngespinsten schüttelte der junge Mann mit aufgerissenen Augen hektisch den Kopf und blickte sich konzentriert um. Da erblickte er zu seinem Entzücken Fußabdrücke im munter grünen Gras und begann diesen, trotz seines nun grummelnden Magens, zu folgen. Kindlich stolzierte er durch das schattige Reich des Waldes, zwischen hohen Eichen und durch so manche kleineren Büsche, immer den Fußspuren nach, die er nur wenige Stunden zuvor gelegt hatte. Es brach schon der Abend an, als er endlich etwas pechschwarzes zwischen den Bäumen aufblitzen sah. Müde und hungrig hechte der Junge zu seinem geduldig wartenden Begleiter, schloss den Kofferraum auf und bediente sich an den reichlichen Vorräten, die er eingepackt hatte. Als er wenige Minuten später erleichtert am Auto lehnte, kam ihm wieder die Angst in den Sinn, die er empfunden hatte, als er alleine und orientierungslos im Wald stand. Dass er überhaupt über einen Tod an diesem Ort nachgedacht hatte, erzeugte große Wut in ihm:
Er war doch erst seit einem halben Tag hier und hatte schon so große Furcht? So würde er niemals frei sein. Niemals den Weg finden, den er um jeden Preis betreten wollte. Schämen sollte er sich, wie ein verschrecktes Tier fast die Flucht ergriffen zu haben.
Während die Wut und Vorwürfe wie eine Welle auf ihn niederkrachten, bemerkte der Wütende nicht den Niedergang der Sonne und ihr güldenes Farbenspiel, dass den Wald ein letztes Mal in einen edlen Glanz tauchte, bevor die Nacht diesen gänzlich verschlang. So schreckte er erst aus seinen Gedanken auf, als jener von völliger Dunkelheit ummantelt war. Ein eisiger, für den Hochsommer untypischer Luftzug pfiff durch den Wald und ließ ihn erzittern, weshalb er sich in das Innere seines Wagens begab und mit seiner weißen Wolldecke umgeworfen auf der Rückbank kauerte.
Mitten in der Nacht jedoch, weckte ihn eine sanfte Stimme: „Was tust du, Einsamer? Was fühlst du, Einsamer?“ Verwirrt schreckte er aus seinem traumlosen Schlaf auf und blickte sich angsterfüllt um. „Hab keine Angst, Einsamer. Trete hinaus zu mir“, hörte er die Stimme nun sagen. Vorsichtig öffnete er die Wagentür und lief ein paar Schritte in Richtung des Dickichts, von dem die Stimme zu kommen schien. „Schau nach oben, Einsamer. Hier bin ich.“, sagte die Stimme nun. Als er der Junge seinen Blick also nun gen Baumwipfel richtete, sah er auf einem Ast über ihm zwei gelb-leuchtende, gespenstische Augen, die ihn anfunkelten. Sie gehörten zu einer Eule, weiß wie Schnee und von beachtlicher Größe. So groß, dass der eben Erwachte ehrfürchtig sich mehrere Schritte zurückbewegte.
„Ich bin die Wächterin der Grenzen. Die Hüterin von Tag und Nacht. Eine weise Parabel vom Mondlicht erdacht. Was bringt dich hierher? Was hoffst du zu sehen?“
„Ich suche den Weg und die Freiheit. Einen Sinn könnte man sagen“, antwortete der Einsame zögerlich.
„Der Weg ist knorrig und die Freiheit befleckt. Allein deine Worte sind paradox. Orientierungslos.“
„Und doch bin ich hier. Auf der Suche.“
„Doch finden wirst du nichts. Nicht, solange du dein Herz und deinen Verstand der Natur verschließt. Deine Selbstzweifel fesseln dich an deine bleischweren Sorgen, ziehen dich in einen Abgrund der Menschlichkeit, einen Strudel der Absurdität.“
„Dann sag mir, Eule, wie kann ich mich davon lösen?“, klagte der junge Mann, während ihn eine kühle, nächtliche Brise erfasste. Doch die Eule blickte nur stumm in die Ferne, in den dunklen, nun mehr gespenstisch als einladend scheinenden Wald und breitete mit einer plötzlichen und doch grazilen Bewegung ihre weißen Schwingen aus, um schließlich, ehe er es sich versah, in der Dunkelheit wie eine Farbtropfen auf einer Leinwand zu verschwimmen.
Als er am nächsten Tag erwachte, schien ihm die Begegnung mehr als surreal. Er wiederholte die Worte des weisen Tieres in seinem Verstand, doch war es die Deutung, die ihm fernblieb. Nach einem ausgiebigen Frühstück, fasste er schließlich den Beschluss weiterzuziehen. Mit neugeschöpftem Mut folgte er dem mit tausenden Wurzeln übersäten Waldweg bis in das Herz des Waldes, das selbst die Sonne nur geringfügig erreichte. Dort war es still. Das kämpferische Poltern seines Autos mit den Wurzeln war das einzige Geräusch, das durch die leeren grünen Hallen tönte. Und doch fühlte er keine Reue und keine Furcht in ihm, denn ein ihm unbekannter Wille, plötzlich entsprungen aus den Tiefen seiner Selbst, vielleicht mit Heldenmut gleichzusetzen, trieb in voran. So war es jener Wille, jenes dumpfe Gefühl der Entschlossenheit, was ihn plötzlich auf die Bremse treten ließ und den Wagen abrupt zum Stehen brachte.
Der Junge war sich sicher: Hier würde er die Freiheit und den Weg finden. Er wusste es einfach. Die Umgebung schien in ihrem intensiven, ja beinahe penetranten grün so außerweltlich, dass sich kurz die Angst selbst um seine Schultern legte. Nichtsdestotrotz nahm er ein wenig Proviant und setzte seinen Weg zu Fuß fort.
Nach vielen Stunden des Wanderns erblickte der Suchende etwas äußerst Ungewöhnliches: So windete sich ein großes Gebilde, einem Turm ähnelnd, vor ihm aus dem Boden des Waldes bis über die Baumwipfel mit steinernen Stufen, die dicht von Moos bewachsen waren. Vorsichtig bestieg er das Gebilde, Stufe für Stufe, bis er schließlich müde und schweißgetränkt auf der Spitze ankam. Aber er war nicht alleine dort oben:
Der Weg war ein alter Mann mit gebräunten, knöchernen Gliedmaßen und langem, zerzaustem Haar, an welches sich ein langer, grauer Bart anschloss, der ihm bis zu seinen nackten Füßen reichte. Als Kleidung trug er nicht mehr als ein langes, bräunliches Gewand mit vielen Flecken, vermutlich entstanden durch den Erdboden, welches ihm bis zu den rötlichen Unterschenkeln reichte. Sein langes Gesicht war genauso abgemagert wie der Rest seines Körpers und seine Lippen waren schmal und matt. Der Weg stand nur wenige Meter vor dem jungen Mann und blickte in dessen Richtung, doch bei genauerer Betrachtung fiel ihm auf, dass seine stechenden, himmelblauen Augen etwas hinter ihm betrachteten.
„Wunderschön, wirklich wunderschön sind sie.“, murmelte der Weg mit einem dezenten Lächeln. Da erst blickte der Junge in die Richtung und sah am fernen, dämmernden Horizont die Lichter einer Stadt, seiner Stadt. Die Stadt, die ihn mit ihren Hochhäusern und verregneten Gassen aufwachsen lies und doch durch ihre Menschenmassen erdrückte.
„Was soll so wunderschön an ihr sein? Sie ist bedrückend, kantig und verschmutzt. Lärm kommt aus allen Ecken. Nichts davon ist schön.“, antwortete das Kind jener Stadt unversöhnlich.
„Nein Junge, nicht die Stadt. Die Menschen sind wunderschön, ihre Herzen sind wunderschön.“, sprach der Weg nun, doch der Junge blieb bitter:
„Die Menschen sind egoistisch. Sie denken nur an sich und schränken sich gegenseitig ein. Sie neiden und prahlen. Sie betrügen und lügen.“
Doch der Weg sprach weiter mit ruhiger, träumerischer Stimme:
„Und doch schaust du nicht hin, Junge. Blicke genauer!“
Obwohl die Worte des alten Weges ihn verwirrten, blickte er erneut auf die Stadt, nur eine dunkle Silhouette in der Ferne wie ein einsames Schiff auf dem grünen Ozean. Und dann sah er sie: Die vielen kleinen Lichter, Millionen von ihnen, die die Stadt aufleuchten ließen, wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Wimmernd fiel der Einsame auf die Knie und verbarg seine Tränen mit seinen Händen. Ein unvorstellbares Heimweh durchzog ihn, wie die Reue, die er nun für seine Blindheit empfand.
„Du hattest immer ein Ziel und einen Weg, Junge. Es waren deine eigenen Selbstzweifel, die Eisentür, die du vor dein Herz gesetzt hattest, die dich unfrei machte. Diese Lichter, sie sind die Herzen, die ewigen Laternen, die ein Menschenkind durchs Leben führen“, erklärte der Weg mit einem warmen Unterton in seiner Stimme. „Du warst nie einsam, niemand ist wirklich einsam. Einsamkeit entsteht dort, wo der Zweifel auf das Selbst trifft, wo sich der Mensch den Wert nimmt.
Der junge Mann dachte an die Eule. Sie hatte von Ähnlichem gesprochen, nur hatte ihm seine Unzufriedenheit damals die Deutung verwehrt. Nun aber verstand er. Langsam richtete er sich auf, trocknete seine Tränen und wollte sich gerade beim Weg bedanken, aber als er sich umdrehte war dieser verschwunden.
Mit neu erwecktem, kindlichem Elan und einem herzlichen Lachen tobte er durch den Wald, sprang geschickt über die Wurzeln am Boden und fand nach überraschend kurzer Zeit sein Auto wieder. Dankbar begab er sich hinters Steuer und trat den Rückweg an. Staunend betrachtete er die tausenden Sterne, die ihm den Weg nach Hause wiesen und blickte ein letztes Mal voller Dankbarkeit auf den Wald mit all seinen Wundern, bevor er die graue Straße betrat, die in vor wenigen Tagen hierher geleitet hatte.
Diese Stadt, die für ihn und seine Familie, sowie für viele Menschen ein Zuhause darstellte, schien nun mehr wie ein Freund, ein alter Bekannter, den er lange nicht gesehen hatte. Er war frei, nein, er war immer frei gewesen.